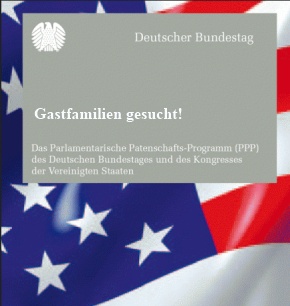Für das Verständnis der europäischen Kultur und für das gegenseitige Verständnis der europäischen Nachbarn bildet historische Forschung ein gemeinsames Fundament. Eine wichtige Brücke historischer Forschung zwischen Osteuropa und Deutschland wird durch die Zusammenarbeit des Zentrum für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften (Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie (PAN)) und dem Geisteswissenschaftlichen Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas e.V. an der Universität Leipzig (GWZO) gebildet.

DAS HISTORISCHE UMFELD DER TAUFE MIESZKOS IM JAHR 966
Das Zentrum für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften (PAN) ist im ehemaligen Haus des polnischen Botschafters am Majakowskiring 47 im Pankower Städtchen beheimatet.
Das PAN organisiert gemeinsam mit dem Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften sowie dem Geisteswissenschaftlichen Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas e.V. an der Universität Leipzig vom 10. bis zum 11. Juni 2016 in Berlin eine wissenschaftliche Konferenz zum Thema der Anfänge des Christentums in den Ländern östlich der Oder.
Im Mittelpunkt steht eine schon lange verstorbene „Schlüsselperson“ der Geschichte, mit der die „geschriebene“ Geschichte Polens begann: Piasten-Herzog Misaca, der später Mieszko I. genannt wurde.
Mit der Taufe von Mieszko I. vor 1.050 Jahren und der Entwicklung eines ersten Staatsgebildes auf dem Gebiet des polnischen Landschaftsteils Polonia maior (Posen-Gnesen-Kalisch) entstand der historische Kern Polens.

Mit der Taufe vor 1050 Jahren begann die Christianisierung
Das anstehende 1050. Jubiläum der Taufe Mieszkos I. ist Anlass, nicht nur den gegenwärtigen Forschungsstand und die neuesten Ergebnisse der historischen Forschung vorzustellen. Es soll auch die Frage diskutiert werden, welche Faktoren den Ausschlag dafür gaben, dass sich das Christentum als Religion durchsetzte und sich als ein entscheidendes Element der zukünftigen polnischen Staatlichkeit erwies.
Dabei geht es um neue Perspektiven der interdisziplinären und komparativen Forschung (Geschichtswissenschaft und Archäologie) in Bezug auf Fragen zur Organisation von Herrschaft und zum Wandel der Sozialstrukturen im frühen Mittelalter. Auch sollen die verschiedenen Optionen des Glaubenswechsels thematisiert werden.
Die Vermutung steht noch im Raum und muss historisch geklärt werden: „War Mieszkos I. (geb. ca. 922, gest. 992) so etwas wie ein „früher Europäer“? Denn es gibt Quellen, die seine normannische Abstammmung belegen. Eine Urkunde aus dem Jahr 990, die in den Archiven des Vatikans verwahrt wird, in Form eines Regest ( Zusammenfassung einer Urkunde, deren Original verschollen ist) scheint es zu belegen. In dieser Urkunde, die nach den in der Anfangszeile erwähnten Worten Iudex (Herr, Richter) Dagome „Dagome Iudex“ benannt wurde, unterstellt der Piastenfürst sein Land dem direkten Schutz des Papstes.
Dagome Iudex gilt als eine wichtige Quelle zur Gründung bzw. Anerkennung des polnischen Staates und dessen Eingliederung in die christliche Gemeinschaft. Es beinhaltet auch die älteste geografische Beschreibung der politischen Grenzen des Gebietes des Fürsten, der in der Urkunde unter dem normannischen Namen Dagome (vgl. Dagö, Dagobert) geführt wird.
Für die polnische Geschichtsforschung ist die Frage der Abstammung noch offen. Ein angestrebter genetischer Nachweis ist nicht möglich, weil das Grab von Mieszkos I. unbekannt ist.
Geschichts-Krimi: Waren Polen schon immer die größeren Europäer?
Die Frage der Abstammung ist ein bedeutsames Thema für ganz Europa! Denn Mieszkos Enkelsohn Knut wurde König von England, Norwegen und Schweden, und wurde im Dom von Winchester in England bestattet. Gut erhaltenes genetisches Material könnten auch die sterblichen Überreste von Inegerda, der Urenkelin Mieszkos, liefern. Inegerda hat in Kiew ihre letzte Ruhestätte gefunden.
Die Herkunft und Abstammung von Mieszkos I. berührt ganz Europa, und vor allem Osteuropa.
Die Tagung führt deshalb auch Historiker und Forscher aus ganz Osteuropa zusammen: Oleksiy Tolochko aus der Ukraine referiert zu Glauben und Christenheit in Kiev während des 10. Jahrhunderts. Der polnische Historiker Władysław Duczko sucht nach Anfängen des Christentums in Skandinavien, Martin Wihoda widmet sich den Anfängen des Christentums in Böhmen – und Vincent Múcska behandelt die Annahme des Christentums in Ungarn.
Europäische Dimensionen der Christianisierung untersucht Teresa Rodzińska-Chorąży, indem sie frühpiastische Architektur in einem europäischen Kontext betrachtet. Marcin Wołoszyn betrachtet die Christianisierung des östlichen Polens als Kontaktzone von West- und Ostkirche im Lichte der archäologischen Forschungen.
Neue Erkenntnisse zur Germania Slavica
Prof. Dr. Christian Lübke vom GWZO in Leipzig leitet die „Projektgruppe“ des DFG-Projektes „“Germania Slavica“ als westlicher Rand Ostmitteleuropas und der mittelalterliche Landesausbau zu deutschem Recht in Ostmitteleuropa“.
Lübkes Vortrag wird mit Spannung erwartet, denn er begibt sich auf die ersten Spuren des Christentums bei den Elbslaven und untersucht dessen Rezeption und Aversion.
Chronistik, Numismatik, Archäologie
Vorträge zur Chronistik, Archäologie und Numismatik stellen ein Gesamtbild her: Eduard Mühle betrachtet die Annahme des Christentums im Spiegel der polnischen Chronistik und deren Narrationen und Interpretationen. Przemysław Urbańczyk zeigt Ergebnisse der Archäologie und die Anfänge des Christentums in Polen. Mateusz Bogucki liefert wichtige Erkenntnisse über Münzen als Mittel der Verbreitung des Christentums in Ostmitteleuropa.
Spuren in frühchristliche Zeit
Der zweite Tagungs-Tag am 11.Juni widmet sich den vorchristliche Glaubensvorstellungen und ersten Spuren des Christentums in der Peripherie der piastischen Herrschaftgebiete. Jacek Poleski betrachtet das Gebiet Kleinpolen, Sławomir Moździoch richtet den Blick nach Schlesien. Und Marian Rębkowski findet erste Souren des Christentums bei den Pomoranen.
Krieger und Kleriker haben als „Migranten der frühen Piastenzeit“ den Landesausbau vorangetrieben: Andrzej Buko betrachtet die Funde von Bodzia (Wojewodschaft Kujawien-Pommern) und ihre Bedeutung für die frühe Geschichte Polens. Matthias Hardt liefert schließlich wichtige Erkenntnisse über Magdeburg und die Anfänge des Bistums Posen/Magdeburg.
Wachsendes Interesse für europäische Geschichte
Prof. Dr. Igor Kąkolewski, stellvertretender Direktor des Zentrum für Historische Forschung war sehr erfreut, dass diese Tagung auf Interesse stößt.
Gemeinsame europäische Geschichte und kulturelle Verbindungen werden sichtbar. Der Blick auf ein lange miteinander verwobenes Europa öffnet sich. Die Christianisierung hat lange und bis heute fortwirkende Verbindungen geschaffen, die ein Fundament für heutigen Dialog und Verständigung sind.
Die gemeinsame polnisch-deutsche und osteuropäische Geschichtsforschung liefert zudem heute ein viel weiteres Bild, vor allem auf die Zeiten vor Beginn der märkischen Geschichtschreibung und die Zeit der „beurkundeten Stadtgründungen“.
Dort wo noch heute manche deutschen Historiker „märkische Gründungen aus wilder Wurzel“ beschreiben, war in der Germania Slavica schon längst die Basis europäischer Kultur begründet.
Die Tagung wird übrigens simultan übersetzt – eine gute Gelegenheit, zur Verständigung!
INFORMACJE PRAKTYCZNE/ PRAKTISCHE HINWEISE
KIEDY/WANN: 10. -11. CZERWCA 2016, GODZ. 9:00/10. -11. Juni 2016, 09:00 Uhr
GDZIE/WO: Zentrum für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie
Majakowskiring 47
13156 Berlin
ZGŁOSZENIA/ANMELDUNG: malgorzata.quinkenstein@cbh.pan.pl
GWZO Germania Slavica – DFG-Projektgruppe – Link