Das im Juni erschienene Buch von Peter Sloterdijk hat schon die Spiegel-Bestseller-Liste erklommen. Auch wenn Einband und Titel neu sind, so versammelt „Nach Gott“ zwölf Essays, Vorträge und Buchauszüge, die im Zeitraum 1993 bis 2017 entstanden sind.
Sloterdijk bleibt seinem Stil treu, der kenntnisreiches Assoziieren, philosophisches Selbstreflektieren oder Selbstgespräch mit einem historischen Parforceritt durch die Theologie und Mentalitätsgeschichte verbindet.
Natürlich musste zum Lutherjahr auch eine Provokation erscheinen: in dem Kapitel „Ist die Welt bejahbar?“ wird die Person Luther von Sloterdijk als „Neurotiker“ und „christlicher Salafist“ angegriffen, dem ideengeschichtlich Glück widerfahren ist.
Sloterdijk: „Luther gehört zu den seltenen Figuren der kulturellen Evolution, von denen man sagen darf, sie hatten ideengeschichtlich Glück. Vom Glück begünstigt ist man auf diesem Feld, wenn man bessere Nachfolger findet, als man verdient hat.“
Sloterdijks Provokationen sorgen für eine Dialektik, die das lesende Individuum zur Selbsterkenntnis treibt: „Du mußt dein Leben ändern.“ – Das Motiv der Anthropotechnik wurde in jenem Buch „ausgerollt“. In „Nach Gott“ will Sloterdijkt offenbar die letzten Glaubensreste der Religion zertrümmern, damit das Individum endlich zur Kreativität befreit wird: „Wo Götter waren, sollen Menschen werden.“
Der Autor wandert in seinen Texten durch 2.500 Jahre Kultur- und Geistesgeschichte, die Jaspers, Kierkegaard, Heidegger und die ›jesuanische Ekstatik‹ mit einschliessen. Iin seinem neuen Buch zieht Sloterdijk zum ersten Mal alle Konsequenzen aus dem Satz »Gott ist tot«. Alle Bereiche der aktuellen Theologie und Philosophie kommen ins Spiel, wie die mörderische Politik der Gegenwart oder die unmittelbaren kulturellen und wissenschaftlich-technischen Entwicklungen.
Sloterdijks Metaprojekt ist eine Theorie der Gegenwart, die die von Religion seit dem Mittelalter ausgelösten Paradoxien und Konsequenzen auflöst, und vor allem den triumphierenden Fundamentalismus auflöst.
Die christlichen „Apparatkirchen“ sieht Sloterdijk in der Krise. Sie hätten inzwischen „eher subkulturellen Charakter angenommen“, und seien auch „Unternehmen zur Selbstverwaltung der Melancholie über die Unmöglichkeit von Kirche.“
Stark ist Sloterdijks Verdikt über den Islam: Der Terror der Islamisten innerhalb und außerhalb des „Hauses des Islam“ stelle die „Vollzugsform der Allah-Dämmerung dar.“ Sloterdijkt sieht Attentate als „missratene Beweise eines Gottes, der die Welt nicht mehr versteht.“ Sloterdijk kritisiert auch die Unterentwicklung: „Tatsächlich nehmen die islamisierten Nationen summa summarum an der schöpferischen Moderne, insbesondere in ihren technischen Zuspitzungen, bisher nur vom Standpunkt des Anwenders teil.
„Sie haben sich nicht auf das Plateau der »technischen Existenz« begeben. Sie produzieren nicht, was sie benutzen; sie generieren nicht, was sie in die Hand nehmen. Sie haben die translatio creativitatis weder akzeptiert noch als Aufgabe der Zeit begriffen.“
Doch hier irrt Sloterdijk gründlich, und ist nicht ganz auf der Höhe der Zeit. Neben dem Bombenbau des IS, neben Waffenbau und improvisierten KfZ-Werkstätten nicht. gibt es längst eine Modernisierung. Allein in Saudi-Arabien arbeiten heute über eine Million Menschen im verarbeitenden Gewerbe und in der Industrie. Und auch die Türkei kann islamischen Glauben längst mit Industrie und Designwirtschaft verbinden.
Nach Götterdämmerung und Zivilisationsdämmerung sieht Sloterdijk eine Seelendämmerung heraufziehen, sowie – qua Roboterisierung und Automatisierung – eine Intelligenzdämmerung. Er könnte recht behalten, doch Sloterdijk schließt mit einem optimistischen Diskurs zur Philosophie von William James, der „Chancen im Ungeheuren“ sieht, und im Glauben des Individuums an sich selbst.
Über den Autor
Peter Sloterdijk feiert am 26.Juni 2017 seinen 70. Geburtstag. Der Sohn einer Deutschen und eines Niederländers studierte von 1968 bis 1974 in München und an der Universität Hamburg Philosophie, Geschichte und Germanistik. Seiner Magisterarbeit mit dem Titel Strukturalismus als poetische Hermeneutik aus dem Jahr 1971 folgten bald darauf ein Essay über Michel Foucaults strukturale Theorie der Geschichte sowie eine Studie mit dem Titel Die Ökonomie der Sprachspiele. Zur Kritik der linguistischen Gegenstandskonstitution. Peter Sloterdijk wurde 1976 von Professor Klaus Briegleb zum Thema Literatur und Organisation von Lebenserfahrung. Gattungstheorie und Gattungsgeschichte der Autobiographie der Weimarer Republik 1918–1933 promoviert.
Seit den 1980er Jahren ist Sloterdijk als freier Schriftsteller tätig. Sein 1983 erschienenes Buch Kritik der zynischen Vernunft zählt zu den meistverkauften philosophischen Büchern des 20. Jahrhunderts. Seinen ersten Roman legte Sloterdijk 1987 mit Der Zauberbaum. Das Werk von Peter Sloterdijk wurde schon in 35 Sprachen übersetzt.
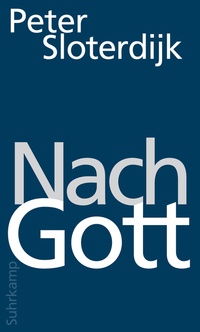
Peter Sloterdijk
Nach Gott – Glaubens- und Unglaubensversuche
Erschienen: 13.06.2017
(Gebunden), 364 Seiten, 28.00 €
ISBN: 978-3-518-42632-6




